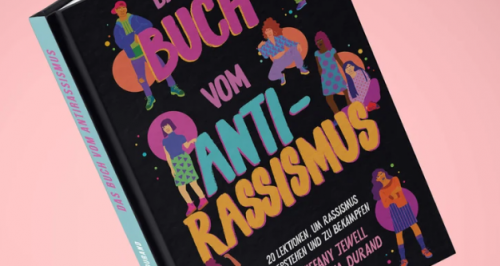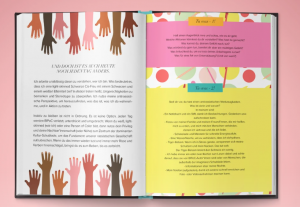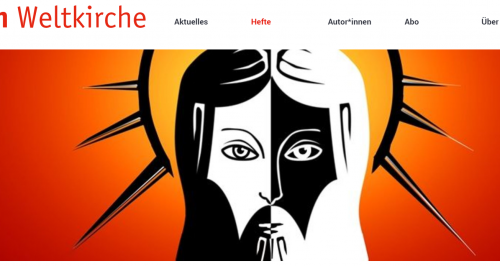In einigen südamerikanischen Ländern verkaufte der Weltkonzern Nestlé 60 Jahre lang eine Kekssorte mit dem Namen „Negrita“. Der Konzern hat sich im Zuge der Rassismus-Debatte von diesem Namen verabschiedet und vertreibt den Keks unter dem Namen „Chokita“. In Australien hat der Konzern seinen „Red Skin“ Lutscher in „Red Ripper“ umgetauft. In den USA musste Aunt Jemima gehen, die Jahrzehntelang mit Pfannekuchen assoziiert wurde, und der weltbekannte Uncle Ben’s Rice des Lebenmittelkonzerns Mars Inc. soll fortan nur noch Ben’s Rice oder Ben’s Original heißen.
„We have a responsibility to help end racial injustices. We’re listening to consumers, especially in the Black community, and our Associates. We don’t yet know what the exact changes or timing will be, but we will evolve Uncle Ben’s visual brand identity.“ schrieb die Firma auf ihrer Instagramseite
Auch in Deutschland ist die Debatte bei Markenherstellern inzwischen angekommen. Der Lebensmittelhersteller Knorr, bekannt für Suppen und Soßen, hat vor knapp einem Jahr (im August 2020) seine „Zigeunersauce“ , die seit über 100 Jahren einen festen Platz in deutschen Küchen hat, aus dem Sortiment genommen. Oder besser gesagt, umbenannt. Denn die Sauce gibt es noch. „Da der Begriff ‚Zigeunersauce‘ negativ interpretiert werden kann, haben wir entschieden, unserer Knorr Sauce einen neuen Namen zu geben“, sagte ein Firmensprecher damals. Weiter lesen auf DiasporaNRW.net