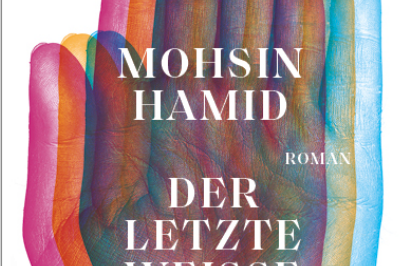Der neue Film des irakischen Filmemachers Samir vereint viele Themen, die mit geflüchteten Menschen, die in der Diaspora leben, verbunden werden: eine unterdrückte Frau, die in die Fremde flieht, um ihre Freiheit zu finden, ein schwuler Mann, der nur im Exil seine Homosexualität ausleben kann, ein Jugendlicher, der in einer weltoffenen Stadt wie London lebt, und sich dennoch muslimisch radikalisiert.
In dem kleinen Café Abu Nawas des kurdischen Aktivisten Zeki versammeln sich in London lebende Exil-Irakis. Der Café-Besitzer und seine Frau bieten so etwas wie ein Stück Heimat in der Fremde. Während auf dem Fernseher alte Musikvideos aus der Heimat flimmern, treffen sich hier unterschiedliche Menschen um zu diskutieren, Zeitung zu lesen, Tee zu trinken, Feste zu Feiern. Was sie verbindet ist die schmerzliche Erinnerung an eine gemeinsame, verlorene Heimat. Zu den Stammgästen gehört der Dichter Taufiq (Haytham Abdulrazaq), der nun als Nachtwächter in einem Museum arbeitet. Er kümmert sich um die Witwe seines im Irak ermordeten Bruders und um seinen Neffen Nasseer (Shervin Alenabi). Taufiq schätzt die Freiheit der Demokratie. Gleichzeitig versucht er Kultur und Sprache der alten Heimat lebendig zu halten indem er weiterhin seine Gedichte schreibt. Seinem Neffen versucht er beizubringen, beides zu schätzen. Doch Nasseer gerät immer mehr unter dem Einfluss eines islamistischen Predigers, der in der örtlichen Moschee junge Männer indoktriniert und Hass gegen Schwule, Ungläubige und den westlichen Lebensstil schürt. Auch Muhanad (Waseem Abbas) ist regelmäßiger Gast im Café. Der junge IT-Nerd kann in London, anders als in Baghdad, seine Homosexualität offen ausleben. Trotzdem sträubt er sich, seinen Freund im Café vorzustellen. Die Architektin Amal (Zahraa Ghandour) ist mit falschen Papieren vor ihrem ihrem gewalttätigen Ex-Mann (Ali Daeem) aus dem Irak geflüchtet. Nun arbeitet sie als Kellnerin im Café und freut sich über ein Leben in Freiheit und ein neues Glück, das sich langsam anbahnt. Doch dann taucht eines Tages ihr Ex-Mann Ahmed Kamal im Café auf. Er ist der neue Kulturattaché seiner Botschaft, genießt Diplomatenstatus und hält nichts von freiheitlich demokratischen Werten.
Die Erzählung wechselt zwischen bedrückenden Verhörszenen auf einem Londoner Polizeirevier und Ausgelassenheit im Café. Die Geschichte wird nicht linear erzählt sondern springt vor und zurück. Es ist etwas schreckliches passiert, doch der Zuschauer ahnt nur allmählich, was das ist. Die Exilanten leben nun in einer offenen, multikulturellen Stadt, was deutlich wird, wenn die Kamera durch Straßen und Stadtviertel, an einem Waschsalon namens Colorful, an Frauen mit Kopftuch, an Menschen mit vielen unterschiedlichen Hautfarben, vorbei schweift. Doch in einem freien Land zu leben heißt nicht unbedingt in Freiheit zu leben. Freiheit kann auch überfordern, was Samir an der Figur Nasseers verdeutlicht, und die langen Arme diktatorischer Regimes reichen manchmal auch bis ins Exil und lassen die Freiheit manchmal an einem seidenen Faden hängen, wie Amals Figur zeigt.
Samir spricht viele gesellschaftliche und politische Themen an – Religionsfreiheit, Gendergerechtigkeit, Frauenrechte, Kulturpflege. Sein Film ist ein Plädoyer für Freiheit, für demokratische Werte und für ein Zusammenleben in gegenseitiger Toleranz.
Regie: Samir, Drehbuch: Samir, Furat al Jamil, Mit: Haytham Abdulrazaq, Shervin Alenabi, Waseem Abbas, Ali Daeem, Kerry Fox, Hazel O’Connor u.v.a.
Kinostart: 30. September 2021