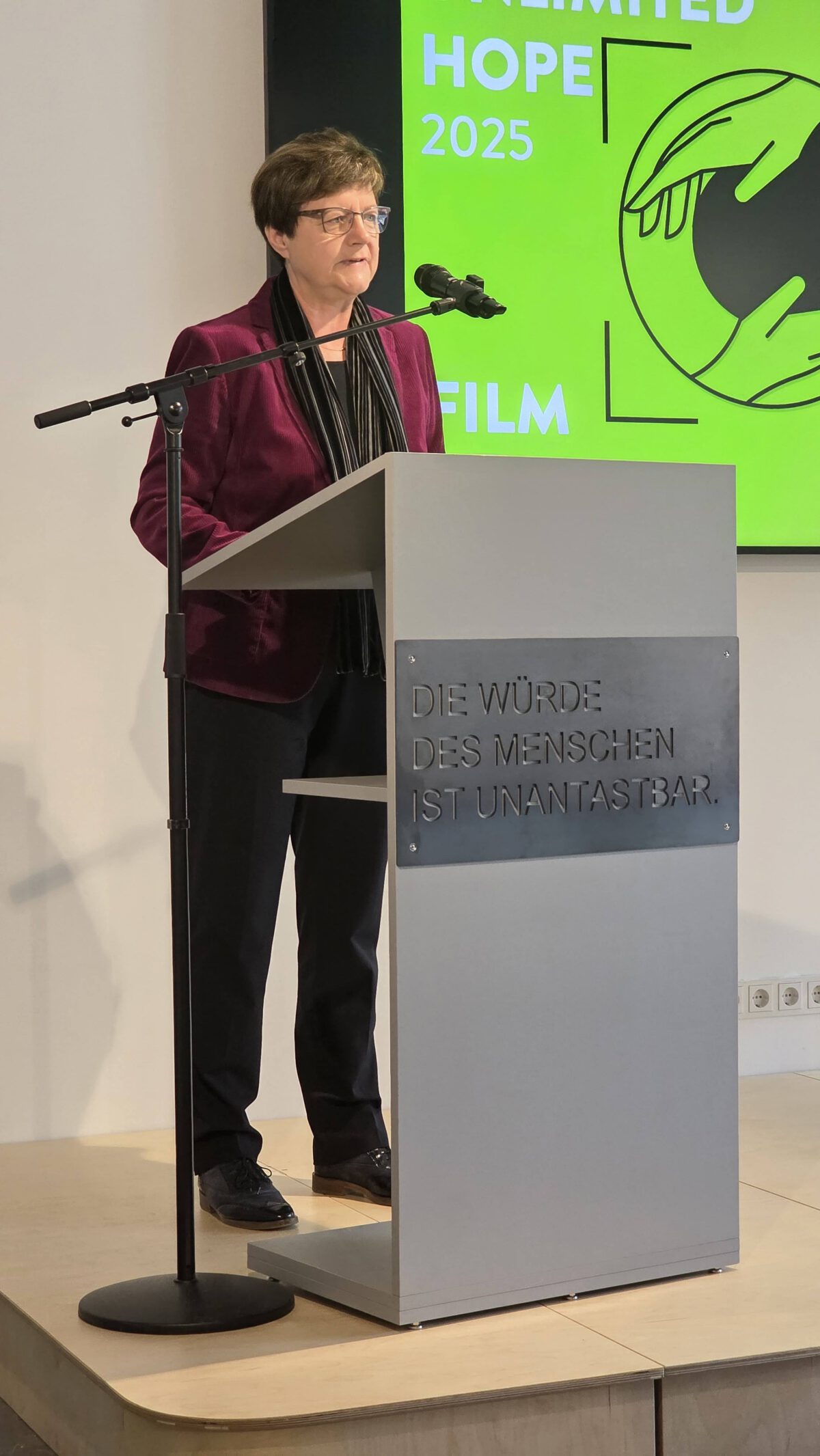Der Klimawandel ist Realität – messbar, zerstörerisch, teuer. In den letzten fünf Jahren verursachten Unwetterkatastrophen infolge des Klimawandels allein in Deutschland Schäden von über 12 Milliarden Euro; zwischen 1980 und 2024 waren es insgesamt rund 180 Milliarden Euro, so ein Bericht der Rückversicherung München Re. Der Klimawandel zeigt sich jedoch nicht nur dramatisch in Überschwemmungen oder Waldbränden, sondern auch schleichend: 2024 schätzte die Welternährungsorganisation FAO, dass bereits rund 10 Prozent der globalen Landflächen von Versalzung betroffen sind – mit der Gefahr, dass es infolge der Klimakrise 32 Prozent werden. Zudem warnten Wissenschaftler im April 2025, dass steigende Temperaturen die Ausbreitung von Schädlingen fördern und damit massive Ernteverluste bei Weizen, Reis und Mais drohen: Bei einer Erderwärmung von zwei Grad könnten sie um bis zu 46 Prozent zunehmen.
Viel Profit, viel Klimawandel
Trotz dieser konkreten Bedrohungen bleiben Regierungen untätig. Auch auf der COP in Belém setzte sich erneut wirtschaftliches Eigeninteresse gegen globale Verantwortung durch. Deshalb protestieren zivilgesellschaftliche Gruppen, sie organisieren Sitzblockaden, ketten sich an und kleben sich fest. Das ist illegal. Doch sind sie deshalb Kriminelle? Oder nicht vielmehr Menschen, die aus Sorge um das Gemeinwohl handeln, während andere in großem Stil Steuern hinterziehen oder ihre Gewinne maximieren?
Elitäre Fantasien
Superreiche wiegen sich in der Illusion, ihr Vermögen werde sie vor den Folgen der Klimakatastrophe bewahren. Vielleicht funktioniert das eine Zeit lang. Für den Großteil der Menschheit gilt das nicht. Millionen leiden schon heute unter Hitze, Dürren, Hunger und Überschwemmungen. Dennoch verharren viele Gesellschaften in trügerischer Normalität – wie der sprichwörtliche Frosch im langsam erhitzten Wasser. Wissenschaft und Aktivist:innen reißen uns aus dieser Lethargie. Dafür werden sie kriminalisiert.
Lesen Sie hier weiter.